Zurück zum Staat? (2) Das BGE
Posted by flatter under kapital , staat[47] Comments
07. Jun 2016 12:55
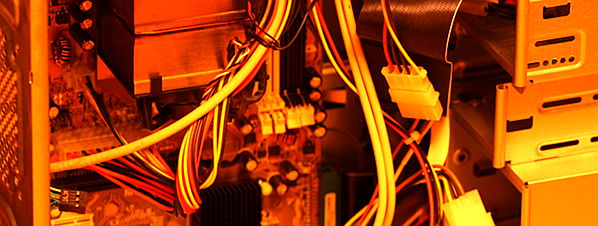
Nicht nur in der Schweiz, in der jüngst eine Volksabstimmung dazu stattfand, wird das Bedingungslose Grundeinkommen diskutiert als ‘Lösung’ der Verteilungsprobleme, die der Kapitalismus mit sich bringt. Der Ansatz ist alt, er wird von einigen Kapitalisten genau so begrüßt wie von Sozialdemokraten; die Ablehnung geht allerdings ebenso durch alle Fraktionen. Ich will dabei gar nicht auf die einzelnen Argumentationen eingehen, die zumeist mit dem groben Keil zur Sache gehen und die komplexen Wirkungen eines solchen Ansatzes nicht berücksichtigen. Diese Argumentationen sind schon deshalb füreinander unzugänglich, weil sie auf völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Wirtschaft beruhen, die häufig erschreckend naiv und simpel sind.
Das BGE scheint aber deshalb diskutabel, weil es am Großen Ganzen nichts ändert und jeder sich seine Vorstellung davon machen kann ohne sich geistig zu bewegen. Ablehnen kann man das, weil sich doch nie etwas ändert und das nur eine weitere Finte des Kapitals ist. Man kann es ablehnen, weil es die faulen Nichtsnutze fördert und dann niemand mehr arbeiten geht oder weil es den Staat ruiniert. Begrüßen kann man es, weil es den Staat entlastet, die Menschen vom Joch der Arbeit befreit oder weil es Automatisierung endlich profitabel macht ohne Sorge um mehr Arbeitslose. Die Einen fürchten Inflation, die Anderen das Gegenteil, weil das BGE für viele unterhalb des Existenzminimums angesiedelt sein würde.
Unter Kontrolle
Im Grunde ist die Diskussion schon gelaufen und erprobt, nämlich in Form des Mindestlohns. Viele Auswirkungen des BGE sind dort bereits eingetroffen. Es gab herzzerreißendes Wehklagen, der Mindestlohn würde Deutschland in den Ruin treiben, und heute wissen wir, dass er nicht einmal die Zahl der Aufstocker gesenkt hat. Von 8,50 € die Stunde kann man nicht leben, vom BGE wird man auch nicht leben können, und wer dann nicht zusätzlich arbeiten geht, findet das Sozialamt wahrscheinlich verwaist. Vielleicht auch nicht, und das BGE wird so hoch angesetzt, dass man drinnen das Volk gut nähren kann (ja, man kann ja mal spinnen), weil der Exportweltmeister draußen reichlich erntet. Dann exportieren wir halt statt der Arbeitslosigkeit die Armut.
Staatliche Konzepte zur Verwaltung des Kapitalismus haben allesamt den Makel, dass sie nur reparieren, korrigieren und verteilen, was die ihm äußere Wirtschaft dem Staat bietet. Das ist ein Grund, warum der ‘Markt’ alles regeln soll, weil nur wirtschaftliche Entscheidungen Einfluss auf die Wirtschaft haben, vulgo: “Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt”. In vielem haben die Neoliberalen recht, wenn es um die Möglichkeiten des Staates geht, nur sind sie nie so ehrlich zu sagen, dass dadurch eine “soziale Marktwirtschaft” völlig unmöglich ist. Kapitalismus beruht auf Konkurrenz, da ist für Solidarität kein Platz. Vor allem, wenn der Reparaturbetrieb in Konflikt gerät mit dem Kapital, wird sehr schnell deutlich, wer von wem abhängig ist.
Jeder Staat, der eine selbständige Wirtschaft zulässt, ist zwangsläufig von ihr abhängig, und zwar umso mehr, je größer die Machtballung in dieser Wirtschaft ist. Im Spätkapitalismus, der Monopole und Superreichtum erzeugt, steht der Staat auf verlorenem Posten, dazu bräuchte man ihn nicht einmal zu korrumpieren. Zumindest in einer Welt komplexer hoch effizienter Produktion und entsprechender Ökonomie ist der Gegensatz von Staat und Wirtschaft nicht mehr zu handhaben. Auf lange Sicht führt dies entweder zu einer voll staatlich kontrollierten Wirtschaft oder zu einer Gesellschaft, die vollständig der wirtschaftlichen Macht unterworfen ist oder zu einer Wirtschaft, die in die Gesellschaft integriert ist (die keine staatliche sein muss). An diesen Möglichkeiten müssen sich realistische Modelle orientieren.
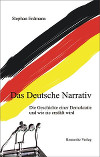


Juni 7th, 2016 at 15:06
Kontrolle. Macht. Unterwerfung.
Egal ob staatlich, wirtschaftlich oder sonst wie. Was uns als “realistische Modelle” angepriesen wird ist die gleiche Kacke wie die der letzten 10.000 Jahren.
Sinnvolle Strukturen müssen nicht aus Zwang heraus entstehen. Wenn die Gesellschaft Kontrollmechanismen braucht stimmt schon mal was grundlegendes nicht. Wir brauchen freie, denkende Menschen und keine dressierten Affen, wie sie heute in “Bildungseinrichtungen” produziert werden. Wir brauchen kleine, übersichtliche Strukturen in denen die Bürger direkt über ihr Leben, ihre Steuern, ihre Wirtschaft bestimmen können. Maximal Kantone und keine Nationalstaaten. Wir brauchen dort möglichst direkte und vor allem konsensorientierte demokratische Strukturen. Ach! Wir brauchen all das was noch in weiter weiter Ferne liegt. Kapitalismus? Kommunismus? Faschismus? Sozialismus? Scheiß drauf! Wer Religionen braucht ist zu faul selbst zu denken und zu feige Verantwortung zu übernehmen.
So. Nun hab ich meinem Frust für diese Woche wieder Luft verschafft. :) Tut gut.
Juni 7th, 2016 at 15:16
“Wenn die Gesellschaft Kontrollmechanismen braucht stimmt schon mal was grundlegendes nicht.”
Die Wirtschaft braucht Kontrolle. Wenn die Menschen nicht entscheiden können, wie sie produzieren und verteilen – was ich Kontrolle nenne, entscheidet eine andere Instanz das. Die Frage ist, wie man das organisiert. Im Übrigen bedarf jede Produktion der Kontrolle, damit sie funktioniert. Es wird also immer kontrolliert, fragt sich nur wer wie.
Juni 7th, 2016 at 17:33
Jedes lohnunabhängie Einkommen hat bisher dazu geführt, dass die Reproduktionsbedingungen der Ware Arbeitskraft sich verschlechtert haben.
Besonders deutlich an Hartz-IV zu erkennen, dass einen riesigen Billiglohnsektor geschaffen und den Druck auf die Beschäftigten zu Mehrarbeit enorm erhöht hat und ebenso den Anpassungsdruck bei den Beschäftigten.
Auch der Mindestlohn stellt keinen sozialen Fortschritt dar, abgesehen von den zahlreichen Ausnahmeregelungen, weil es eben nur ein garantierter Stundenlohn ist und den Unternehmen aufgrund ihrer Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft genug Möglichkeiten verbleiben, ihre Arbeitskraft nur nach Bedarf einzusetzen oder bisher gewährte Sonderleistungen ersatzlos zu streichen, so dass unterm Strich weniger übrig bleibt als vorher.
In Frankreich ist der Mindestlohn inzwischen zu einer Lohnobergrenze geworden und das mit einer Verfügbarkeit der Arbeitskraft von bis zu 13 Stunden mit eingerichteten Zwangspausen. Lohnarbeiter, die mit dem Mindestlohn begonnen haben, sind durchschnittlich auch nach sieben Jahren noch im Mindestlohn verblieben.
Auch hier wollte der Sozialist Hollande eine Änderung herbeiführen, damit ein Mindestlohnempfänger seine rund 1400 Euro vor Abzug der Steuer und Sozialabgaben erreicht. Alles wieder vergessen!
Was mich am BGE stört, dass deren Befürworter keinerlei emanzipatorische Idee entwickeln, sondern die Lohnarbeitslosigkeit als Ausgangspunkt nehmen und dem BGE die Qualität eines ” gesellschaftlichen revolutionären Prozesses” zuschreiben.
Das alles unter der Vorraussetzung, Text Flatter, dass selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass die heimische Wirtschaft erfolgreich in der Weltmarktkonkurrenz besteht (Export der Armut).
Juni 7th, 2016 at 19:11
In Form eines nicht ganz ernst gemeinten Papperlapapp habe ich hier und da kund getan, nicht zu verstehen, was man mir beibringen will. Deshalb freue ich mich, hierorts verständlich und einigermaßen neutral vom BGE zu lesen, dessen Anhänger ich im Prinzip (das heißt: im Prinzip!) bin. Aus der heutigen Gesellschaftsformation finde ich es auch für die nächste Zeit naheliegend, dass sich jemand durch eigene (!) Leistung besser stellen will. Das wird er, falls leistungsfähig, über den Empfang des BGE hinaus tun.
Hier wäre herauszulesen, dass „mein“ Grundeinkommen nicht wesentlich über die Abdeckung der Grundbedürfnisse hinausreicht (nein, hat mit achtfuffzich nichts zu tun, und nein, ich habe die ideellen Bedürfnisse nicht vergessen.) Nach meiner Überzeugung wäre eine solche Basisstufe mühelos „finanzierbar“; man könnte sie auch als Schenkung aller an alle bezeichnen.
Die Keule der Nichtfinanzierbarkeit fliegt deshalb weiter, ist mir schon klar, wie mir klar zu sein scheint, dass sie nicht mehr Gewicht als der berühmte Papiertiger hat. Ich greife dazu die Idee eines gewissen Holger auf, der in einem Blog die Flattax vorstellte, die Steuer auf grundsätzlich jeden Zahlungsvorgang, egalité ob er den Kauf/Verkauf einer Tube Zahnpasta oder eines milliardenschweren Aktienpakets betrifft, das damit einen Teil seines „Wertes“ an die Allgemeinheit Staat abtreten muss. Heftiger noch trifft es das unbewegte Millionärskonto, das sich Tag für Tag der Repräsentation seines inneren Wertes widmet. Der ist Null.
Die Idee wurde seinerzeit bei Feynsinn abgeschmettert (was ich nicht verstanden habe (), wahrscheinlich weil sie Stufen zur Großen Utopie nicht wie verabredet einfach übersprang. Wie auch das, was ich eben zu skizzieren versucht habe.
(ja, geht sicher kürzer, und noch kürzer, wenn man es einfach verschluckt)
p.s.: auch nicht verstanden>>> Staatliche Konzepte zur Verwaltung des Kapitalismus haben allesamt den Makel, dass sie nur reparieren, korrigieren und verteilen, was die ihm äußere Wirtschaft dem Staat bietet.
Was ist äußere Wirtschaft?
Juni 7th, 2016 at 19:25
Die “äußere Wirtschaft” in eine, die nicht der Staat regelt, also Privateigentum, über das die Eigentümer entscheiden. Wenn man denen die Versorgung und die Produktion (von Reichtum) überlässt, ist der Staat nur noch siehe oben. Sozialdemokraten bilden sich gern ein, der Staat könne geichzeitig Privateigentum zulassen und der Wirtschaft sagen, was sie zu tun respektive zu lassen hat. Das ist aber Unsinn.
Juni 7th, 2016 at 19:36
Die Antwort auf immer weiter zurück gehende Lohnarbeitsplätzchen und damit zunehmender Erwerbslosigkeit? Ein fragwürdiges Stückwerk aus 12 Sozialgesetzbüchern mit einem Minimum an Existenzsicherung.
Juni 7th, 2016 at 20:12
@Bruchmüller(4)
@holger hat dabei eine Kleinigkeit ‘übersehen’ – gibt es schon – nennt sich Umsatzsteuer. Wird allerdings mit Vorsteuern verrechnet und das ganz offiziell, also dreist, es würde auf jede Transaktion so umgelegt, den letzten beißen die Hunde, odda so…
Er ist Industriemeister, ich habe mir irgendwie immer ‘gewünscht’, er würde mal eine zündende oder wenigstens ‘interessante’ Idee aus seinem ‘Resort’ präsentieren. ‘Nen Dummer is’ dat Jung ja nun grad mal nich. Ich fand mal ganz gut, als er mit Kleinaggregaten zur Energiegewinnung ‘rum machte’. Feine Sache, für mich gerade dann, wenn kein Geld damit zu machen ist…
bGE würde Dir den Hampelmann beim Amt ersparen. Gönne ich jedem so wie mir, wenn ich da mal wieder auf Hartz muß, wer weiß das schon.
Der Druck wäre mit bGE dann ein anderer und Staat hätte noch mehr Macht (mehr Knete, mehr Macht – siehe Griff in Rentenkassen und so) – den fällt dann schon was ein, warum es dann doch eine Bedingung gibt, die Du nicht erfüllst und sanktioniert Dich.
Wenn Du da jedes Mal erst Zig- und Hunderttausende auf die Straße bringen mußt, das sie das zurücknehmen, naja.
Ich mag das bGE nicht wirklich – am wenigsten – wenn es von oben eingeführt würde.
Stünden viele, viele und noch mehr dafür auf der Straße, dann unterstütze ich sie – weil sich viele für dieses eine Interesse gemeinsam einsetzen.
Den Aufruf dazu, den starte ich ganz gewiß nicht.
Juni 7th, 2016 at 21:59
@ Wat,
“Ich mag das bGE nicht wirklich-am wenigsten-wenn es von oben eingeführt würde.”
Ich habe keine Idee, wer sich diesen Scheiss vom BGE mal ausgedacht hat. Angeblich soll das in den 80ern auch von Linken thematisiert worden sein.
Ich habe auch Verständnis dafür, dass infolge der Hartz-IV-Gesetze ein grosses Bedürfnis besteht, der Schnüffel- und Sanktionspraxis der staatlichen Ämter zu entkommen.
Was also bei Hartz-IV gründlich misslungen ist, breiten gesellschaftlichen Widerstand dagegen zu organisieren, wird jetzt als Angebot für den Staat formuliert, wie das gute Buchhalter eben machen, mit einer Kosten-Nutzen-Analyse.
Und wie das auch unter Linken üblich ist, richten sich daran aus, was finanzierbar ist und stellen allerhand Berechnungen auf.
Was sie dabei auch im Blick haben ist, dass ihr BGE selbstverständlich zur Enteignung von individuell erworbenen Rechten führt.
Und noch weniger kommen sie auf den Gedanken, dass ihr Staat, an den sie sich richten, weiterhin von den Verwertungsbedingungen des Kapitals abhängig bleibt und die Wohltaten des Staates nicht über die Bürger bedingungslos ausgeschüttet werden, sondern nach wie vor eine Bürokratie darüber wacht, welche Einkünfte neben dem BGE so erzielt werden.
Wer daran glaubt, dass im Kapitalismus etwas bedingungslos zu haben ist, der hat ihn nicht verstanden.
Juni 7th, 2016 at 22:05
@ Wat
>>> gibt es schon – nennt sich Umsatzsteuer. Wird allerdings mit Vorsteuern verrechnet <<<
Was ich im Auge habe mit der Flattax sind nicht die Industrie- und schon garnicht die Handwerkerrechnungen, sondern die immer sinnfreier werdenden Zahlungsströme an den "Wertpapier"märkten.
Natürlich bin ich damit auf der Strecke Wunschdenken, Utopie. Und also werden sich besagte Märkte mit ihrer exponentiellen Zerstörungskraft selbst zerfleischen.
Nun flieht schon in die Werte, Leute! In die westlichen, meine ich.
Juni 7th, 2016 at 22:17
@ Troptard
Mir gefällt das immer besser, wenn jemand sagt, dass etwas nicht verstanden worden ist.
Noch bis vor kurzem meinte ich das ironisch.
Juni 7th, 2016 at 22:18
Ich weiß @Bruchmüller(9), die Idee hat ja @holger nicht erst auf Wiesaussieht präsentiert sondern schon auf Weissgarnix – und dort habe ich faktisch ‘gewohnt’ ;)
Auf der Strecke Wunschdenken bin auch unterwegs – nur aus Träumen können Ziele werden…
Wie @Troptard eben auch noch einmal ausgeführt hat – ein/ das bGE ‘lohnt’ mE nicht, da ist es wohl wirklich sinnfüllender, in den jeweiligen Kommunen dafür zu sorgen, daß der Nahverkehr kostenlos wird, Strom die Kommune selber macht und nicht irgendwo einkauft, dann könnten wir dort gucken, wie wir ihn günstig oder kostenlos kriegen.
Ja, ich erlaube mir Träume auch.
… Frauen sollen allerdings (habe ich mir sagen lassen, laß(t) mir einfach die Einbildung) etwas mehr darauf achten, was ihnen beim Schritt nach vorne hintenrum ins Kreuz fällt. ;)
Juni 7th, 2016 at 23:52
…..schaut mal auf den “kiezschreiber” …..der hat einen Artikel übers Grundeinkommen die Tage geschrieben….
Juni 7th, 2016 at 23:59
Früher gab es Sozialhilfe, fertig. War mitsamt Wohngeld und Sonderzahlungen auch existenzsichernd und quasi auch bedingungslos – denn tiefer konnte man nicht abrutschen. Gab, glaube ich, sogar Fortbildungsgutscheine für VHS usw., alles freiwillig.
BGE ist halt auch ein keynsianisches Umverteilungsreformdingsbums, muss sich rechnen.
Sofern existenzsichernd hätte ich nichts dagegen, warum auch? Ohne das sturzdumme Foddernundföddern lebt es sich entspannter am unteren Ende, und das ist immer gut. Der vielleicht emanzipative turn wäre, es auch Migranten einzuräumen.
Juni 8th, 2016 at 02:39
Das BGE würde endlich, zur Abwechslung einmal, die Sache mit der so genannten “Menschenwürde” gegen den neoliberalen Sozialdarwinismus verteidigen.
Und hier sehe ich tatsächlich die Priorität.
first cumz first.
Dass dies und das passieren würde, wenn und dann, oh gott wie schrecklich, ist mir dann zu theoretisch …
Wer ein BGE gegen Schäubles wahnwitzige Idee der “Unsichtbaren Hand des neoliberalismus unter dem Rock der beschissenen Schwäbischen Hausfrau” durchsetzen kann, (ich bin Schwabe, don’ fuk wif me) der könnte auch dafür sorgen, dass die ganzen ifs und whens zur Abwechslung zum Wohle der Gesellschaft ausfallen.
Die Frage ist einzig und allein: wer verwertet das ganze Emotionspotiential des verunsicherten Mobs am effektivsten?
AfD führt leider, wo bleibt Die Linke? Ach so, beschäftigt mit Klein-Klein und selbstanklage, in anbetracht der verzweifelten Umstände völlig Legitim … Kotz.
Lese der geneigte Hobbylinke mal die Rede von Sarah Wagenknecht auf den NachDenkSeiten, und verfalle in Ehrfürchtiges Schweigen oder aber organisiere eine lustige Aktion wie nuit debout oder dem (fast) Generalstreik in F derzeit … zu Praktisch? Zu unintellektuell? Well, the frenchies get the job done.
Juni 8th, 2016 at 08:38
Betreff Mindestlohn, nur mal so am Rande: Um eine Rente > Grusi zu bekommen braucht’s 45 Beitragsjahre und -aktuell- 11,62 € die Stunde. Lasst uns, als erste Reparaturmaßnahme, Löhne < 15 € verbieten (muss auch für 'Schwarzarbeit' gelten) und dann dat Dingen Namens Kap langsam verschrotten und durch etwas Besseres(?) ersetzen.
Juni 8th, 2016 at 11:00
OT: Der Gabriel-Bot hat aus TTIP gelernt: Lasst die Leute abnicken, was sie nicht kennen.
Der Clou: “So soll mehr Marktwirtschaft in das hochreglementierte Erzeugungssystem kommen“.
Eimer!
Juni 8th, 2016 at 11:18
Auch OT: Die Jugend braucht mehr Marktwirtschaft! SCNR. Der CSU-Abgeordnete, der hier eine Jugendliche prostituiert haben soll, ist freilich unschuldig – das meine ich ohne Ironie – und ich halte es nach wie vor für skandalös, dass Namen genannt werden, bevor die Betroffenen verurteilt sind.
Juni 8th, 2016 at 11:54
OT: Aus der Reihe Probleme im Paradies: Anarchos vs. Mafia in Athen.
Juni 8th, 2016 at 14:46
Deckname Habbibi. Lustig :)
Gerade zufällig entdeckt: Letztes Jahr haben die jobcenter 170(!) Millionen Euro durch Sanktionen des ähm: Existenzminimums eingespart. Das reicht schon fast für die nächste Bankenrettung.
Durchhalten, es geht um unser Wixxxtum!
Juni 8th, 2016 at 15:37
Ich komme gern hierher und möchte etwas einwenden.
“häufig erschreckend naiv und simpel” – so aber ist die Wirtschaft, warum sollten die Vorstellungen davon anders sein?
“Staatliche Konzepte zur Verwaltung des Kapitalismus haben allesamt den Makel, dass sie nur reparieren, korrigieren und verteilen, was die ihm äußere Wirtschaft dem Staat bietet.” – wenn wirklich repariert, korrigiert und verteilt würde, wäre das Wichtigste getan. Mehr geht nicht, gegen die unperfekte Natur des Menschen zu kämpfen ist aussichtslos, und es reicht eben eine Minderheit aus, einen ganzen Schaden anzurichten. Aufklärung und Ethik haben ihre Grenzen.
Juni 8th, 2016 at 16:43
“so aber ist die Wirtschaft“.
So? Alles ganz einfach? die schreiben also so dicke Bücher darüber, weil sie doof sind und das nicht erkennen?
“wenn wirklich repariert, korrigiert und verteilt würde”
Ich schreibe doch, dass das auf die Dauer nicht geht. Demnach ist das wie “wenn Wasser trocken wäre”.
” gegen die unperfekte Natur des Menschen zu kämpfen ist aussichtslos”
Hatten wir hier gefühlt tausend mal. Das ist der Satz, mit dem man sich auf die Friedhofsbank setzen kann und warten, bis man dran ist. Aber nehmen wir das für eine Sekunde an, dann interessierte ich mich umso mehr für das System.
Eine Ideologie nach dem Motto: Der Mensch ist schlecht, eigentlich ist alles ganz einfach, wird nur nicht gemacht, taugt dazu, sich ein wunderbar simples geschlossenes Weltbild zu zimmern, aber nicht zur Diskussion.
Juni 8th, 2016 at 22:12
Is zum verrückt werden, je mehr sich zeigt dass das Geld selbst ne Krücke is die nicht dauerhaft trägt hängen die Leutz umso mehr dran. Egal in welcher Form. Ja, es bedarf Zwischenlösungen bis zu einer geldlosen Gesellschaft. Mit dem Ende des Geldes, was eigentlich erreicht ist, da es sich nicht mehr aus sich selbst heraus vermehren lässt, steht auch die Eigentumsordnung zur Disposition. Ob das mit dem Eigentum jemals verstanden werden wird, in seiner Gänze…
Bruderherz hat linkerbeins nen Oberschenkelhalsbruch, fahr morgen das dritte mal in die Klinik…Ladegerät vergessen…,bei Frau Trulla sind och wieder 7 Monate rum, sollte morgen, spätestens übermorgen abklingen…
Und wenn der Systemfrager Zeit hat am Freitag, der Türflügel is 220 hoch, 70 breit, 10 dick (alles in cm ), schlägt die 50 in kg locker, bräuchte da zwei zupackende Hände…
Juni 9th, 2016 at 08:50
“Corporations do not have armies (usually).
They have to manipulate the legislative process in their favour. The currency-issuing state is still supreme – globalisation or not – and the Right know that. The Left have been duped into believing otherwise.”
Interessante Argumente? – See http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33707 …
Juni 9th, 2016 at 10:54
Danke für den Link!
Juni 9th, 2016 at 13:36
@uwej – Aufgabe: Finde den Fehler und begründe, warum diese Studenten tatsächlich zu recht durchgefallen sind…
Juni 9th, 2016 at 13:53
Das ist ja nur die halbe Geschchte. Weil die Klasse durchgefallen war, gab es ein großes Handgemenge, in dem die Faulsten, weil sie die Unsportlichsten waren, mächtig Keile bezogen Sie rächten sich, indem sie die Fließigen mit Messern abstachen. Als so nur noch die Faulen übrig blieben, waren sie nicht mehr fähig, ihren Alltag zu bewältigen, weil niemand mehr da war, der ihnen half. Sie verhungerten in ihren vollgekoteten Hosen.
Juni 9th, 2016 at 16:40
Hmpf. Natürlich auch eine Art, mit dieser hanebüchenen Geschichte umzugehen. Ebenfalls durchaus folgerichtig, allerdings auch wieder nicht gerade diskussionsfördernd. Ich dachte sie eher dadurch zu kontern, dass man zeigt, dass ein zusammengewürfelter Haufen einzelkämpferischer ‘Selbstsorger‘, die dann anschließend nur einer reinen Umverteilung ausgesetzt werden, eben noch lange keine Gemeinschaft und damit auch noch lange keinen ‘Sozialismus’ ergibt. Die Studenten hätten den Vorschlag nur annehmen dürfen, wenn sie sich mindestens auch die gemeinschaftliche Produktion der Arbeiten ausbedungen hätten.
Dein da oben verlinkter Text ist übrigens wirklich große Klasse – vielleicht solltest du ihn nochmal lesen…? :p
Juni 9th, 2016 at 16:40
Ich wäre jetzt bereit Triggerwarnungen auf Feynsinn zu fordern.
Edit: Mal wieder typisch, da kommt jemand mit einer fundierten Argumentation und die jungen Leute plärren wieder mit ihren Triggerwarnungen dazwischen…
Edit 2: Evtl. hätten die Studenten sich auch verbitten sollen, dass die Note von oben vergeben wird. Wenn keiner im Kurs was gelernt hat, dann ist mit Sicherheit auch der Dozent durchgefallen. Hätte man gemeinsam drauf kommen können.
Juni 9th, 2016 at 16:46
Doo kriss reschts unn links Trigger, doo!
Oder auch: Das mit dem Trigger ist kein Messer, das ist was für Fortgeschrittene Selbstsorger.
Juni 9th, 2016 at 16:48
@Amike Edit2 – Arrgh – habe gerade gleichzeitig noch das ‘mindestens’ eingefügt… ;)
Juni 9th, 2016 at 16:50
@ Peinhart: War mir fast klar, dass du auch daran gedacht hast, ich fand es nur erwähnenswert.
@ flatter: Äh, was?
Juni 9th, 2016 at 17:09
Ach so, ihr seid wieder beim Thema, äh …
Alles Käse. Die Studenten haben die schlechte Note (falls es so etwas gibt) tatsächlich verdient, weil sie völlig verblödet und sozial imkompetent sind. Das hat der Prof doch schön herausgearbeitet (wenn man davon absieht, dass die ganze Stroy erfunden ist).
Juni 9th, 2016 at 17:38
@ flatter: Schon, aber ich denke nicht, dass der (hypothetische) Prof. das so gemeint hat. Wenn ich mal davon ausgehe, was mir an der Uni so für Profs begegnet sind. Mein Punkt war eher: Wie de Herr, so es Gscherr.
Juni 9th, 2016 at 18:28
@Peinhart #25
Bitte vorher eine Warnung geben, wenn auch Janich verlinkt wird.
Wem der Text oben nicht gereicht hat, der kann sich auf youtube mal das Streitgespräch Janich versus Staiger anhören.
Das prägt fürs Leben!
Juni 9th, 2016 at 18:39
Also ich war ab 1976 an der “Carl von Ossietzky” Universität in Oldenburg und die Professoren dort, zumindest in meinem Fachbereich Ökonomie, aber auch die, welche im Fachbereich Pädagokik, so meine Beste, erste Sahne.
So ein Gemisch aus DKP-lern, Neuen Linken, immigrierten linken Iranern und der Kritischen Linken.
Was ich heute so an kritischem Bewusstsein mit mir rumtrage, verdanke ich diesen Professoren.
Als Erstes wurden im Ökonomiestudium die bürgerlichen volkswirtschaftlichen Theorien auseinandergenommen, um sie dann zu verwerfen. Der Ravasani, der Iraner, war ein harter Knochen.
Beim Studium der “Kritik der politischen Ökonomie” hat er keine Schläfer geduldet.
Und bei Thomas Blanke, Arbeits-und Wirtschaftsrecht, habe ich zum ersten Mal erfahren, wie reaktionär und einschränkend das deutsche Streikrecht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gestaltet war.
Sein Spruch: Das Arbeitsrecht schützt nicht den “Arbeitnehmer sondern den Arbeitgeber”.
Und weil diese linke Ausrichtung der CDU-Regierung unter Birgit Breuel ein Dorn im Auge war, und auch die Benennung der Universität nach C.v.O, wurde eine Studienordnung verweigert und ich durfte ein Jahr länger studieren als ich wollte.
Ach das waren noch Zeiten, die mir keiner nehmen kann und die mich geprägt haben. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig stolz darauf bin.
Juni 9th, 2016 at 21:45
zu hier: “p.s.: Ich habe OXI bis auf weiteres in die Blogroll übernommen.” das hier zur Info.
Juni 9th, 2016 at 22:01
Zu krittln gibts immer was, aber Norbert Häring hat keine Ahnung was Geld is…
Juni 9th, 2016 at 22:05
@Troptard: Wollte dir aufm 1 Euro Blog antworten, ging nich. Sollte Hausnummern und Flüsse erraten, egal is zwar hier völlig daneben, halts aber für wichtsch…
@Troptard: Zufall, nen kleiner Disskurs…
Werd jetzt nich ausschweifend, könnt locker 4298765 Seiten erlebten Schwachsinn zum Besten geben.
Es bleibt dabei: Mir hats geholfen. Is ne Behauptung. Der berühmteste Detektiv aller Zeiten zu seinem Assi: Beweise, mein lieber Watson, Beweise.
Es ist erschreckend was in der Szene abgeht, hab nach knapp über dreissig Jahren dem Tierarzt meines Vertrauens das selbige entzogen. War vor wenigen Wochen mit nem recht alten Kater (15 oder 16 ) dort. Verdacht auf ne Vergiftung. Das übliche Procedere, dann: In den Haferschleim einige Tropfen dieses Mittels, ein homöopatisches. Nach kurzer Sprachlosigkeit: Hätte da gern “Exkrementum caninum”, bitte in D0, kann ich täglich ein Pfund frisches liefern.
Troptard, schreib aus Frankreich, irgendwo muss der Umbruch einen Anfang haben…
Juni 9th, 2016 at 22:14
@Vogel: Danke für den Hinweis. Das ist ein armseliges Pamphlet. Die Personen sind quasi beliebig gewählt, die aufgeführten Kriterien dürften bei einigen der genannten keine Schnittmengen ergeben und sogar deutliche Widersprüche. So bleiben Assoziationen, mithin das Gegenteil von Wissenschaftlichkeit.Man hätte politische Positionen schon präzise benennen müsen und dann nach Überschneidungen und Gegensätzen suchen müssen. Mache ich hingegen diese Art Syndrom-Diagnose, bei der fünf von 15 Items passen müssen, um in denselben Sack gesteckt zu werden, wird es wirr. Obendrein kann man doch nicht hingehen und diesen Putin-Mist auffahren, um Kritiker von Kampagnen (wie ist das noch gerade mit MH17?) und angebliche Antiamerikaner gleichzusetzen. Aua!
OXI ist trotzdem bislang lesbar, ich will ja nicht die Bubble zementieren.
Juni 10th, 2016 at 10:38
langlode44 meint:
Juni 9th, 2016 at 22:01
>>> Zu krittln gibts immer was, aber Norbert Häring hat keine Ahnung was Geld is…
Sag´s uns. Was ist Geld?
…
Ich lese gerade das 1002. Buch darüber. Ein erstaunlich gutes von einem erstaunlich jungen Wissenschaftler, den zumindest ich als solchen bezeichnen würde.
Carl Hanser Verlag: “Warum eigentlich genug Geld für alle da ist” (Bezogen über Egon W. Kreutzer, wem das was sagt.)
Juni 10th, 2016 at 10:55
” Bertelsmann-Studie Südeuropa verarmt
In Europa ist fast jeder Zweite ohne Job langzeitarbeitslos, das sind rund zehn Millionen Menschen. Sie stellen Politik und Marktwirtschaft infrage – wegen ihrer Perspektivlosigkeit. Eine ernste Gefahr, warnt eine Studie. ” (Spon)
Ja leck mich fett, wenn das bloß jenḿand geahnt hätte …
Juni 10th, 2016 at 11:33
Bertelsmann warnt also vor den Folgen von Bertelsmann. Soll keiner sagen, sie hätten’s nicht gewußt.
Juni 10th, 2016 at 11:51
@Bruchmüller #4
Zu Flattax und warum es eine schlechte Idee (in der vorgeschlagenen Form) ist:
Weil es überhaupt nicht gerecht ist. Selbst wenn mit zunehmendem Lohn oder Kapitalerträgen der prozentuelle Anteil steigt, Luxusgüter besonders stark besteuert werden, usw. ändert es nichts daran, dass absolut eine Minderheit immer noch viel mehr Ressourcen (in Form von Geld) haben und somit auch politische Macht.
Wenn jemand von einer Millionen im Jahr selbst 70% über Steuer an die Allgemeinheit abgibt, bleiben ihm absolut dennoch 300k. Wenn einer mit 40k Jahresgehalt nur 30% abgibt, bleiben ihm absolut trotzdem 10x weniger als dem erstgenannten. Wer Geld und (politische) Macht nicht als zwei Seiten der gleichen Medaille verstanden hat, ist eigentlich noch nicht bei der richtigen Debatte angekommen.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Verteilung von Lohn/Kapitalerträgen oder Steuergerechtigkeit zwar die Umverteilungsthematik tangiert, aber noch lange nicht die Produktionsbedingungen, was und wie wir etwas produzieren oder als Dienstleistung anbieten (also Sinnhaftigkeit/Zweck/Nutzen), Umwelt, Soziales, usw.
Das ist auch etwas, was mich stark an der Fraktion der “Kapitalismus ist TINA, aber muss gezähmt/soziale Marktwirtschaft bla bla” wundert. Mindestlohn und Steuergerechtigkeit liest man oft, aber wo bleibt Forderung nach Maximallohn/Kapital (aus eben oben genannten Gründen)? Beides lässt sich auch mit Verfassung vereinbaren/ableiten. BGE/Mindestlohn über Menschwenwürde und Maximallohn/Kapital über Art. 14, Abs. 2 und 3.
Juni 10th, 2016 at 13:50
@Bruchmüller Nro. 40:Schrieb ich vor geraumer Zeit schon mal. Geld ist eine Lüge, die wohl größte Lüge der der Mensch je erlegen ist.
Hätt auch schreiben können Geld ist Macht, ist Herrschaft und vor allem die Legitimation des kriminell entstanden Eigentums
Bilanzieren ja, finanzieren nein. In die Aktiva kommt der reale Bedarf, in die Passiva die vorhandenen Ressourcen und Leistungsmöglichkeiten. Geld wird hier zusehends obselet, aber sicherlich noch über einen längeren Zeitraum als Verteilungshilfe notwendig sein.
Wenn in 200 Jahren Kinder ins Museum gehen, die bunten Zettel und blinkenden Metallstücke sehen, entgeistert den Ausführungen des Museumsleiters versuchen zu folgen, werden die Kinder die Frage stellen: Was, damals ham die Menschen Papier und Metall gegessen? Nö, werden sie sagen, Museumshans – du spinnst!
Juni 11th, 2016 at 21:17
@Bruchmüller(40) – Wenn tatsächlich genug Geld für alle da wäre, wozu bräuchten wir es dann eigentlich (noch) ;)
Juni 14th, 2016 at 15:06
“so aber ist die Wirtschaft”.
-
‘So? Alles ganz einfach? die schreiben also so dicke Bücher darüber, weil sie doof sind und das nicht erkennen?’
Eben nicht einfach, das Gegenteil war gemeint, ich muß ich klarer ausdrücken. Was erschreckt ist ja das Unerwartete, das irrationale Verhalten eines Systems, das rational zugänglich erscheint (man schreibt und publiziert darüber), es aber in Wahrheit nicht ist.
” gegen die unperfekte Natur des Menschen zu kämpfen ist aussichtslos”
-
‘Hatten wir hier gefühlt tausend mal. Das ist der Satz, mit dem man sich auf die Friedhofsbank setzen kann und warten, bis man dran ist. Aber nehmen wir das für eine Sekunde an, dann interessierte ich mich umso mehr für das System.’
Eben, das ist ja kein toter Satz. K. möchte ein System verändern, nimmt aber zweifach daran teil, als sich selbst alles bedeutendes Individuum und gleichzeitig als bedeutungsarmer Teilnehmer eines größeren Systems. Strikt rationaler Methoden kann er sich nicht bedienen, weil das System hierzu keine Schnittstelle (Methode) bereitstellt. Ein hinreichen träges System kann ja nicht, vor allem nicht zielgerichtet, revolutioniert werden, weil es sich passiv dagegen wehrt. Es wabbelt, am Ende kommt das heutige Frankreich dabei heraus, das war nicht das Ziel.
Also braucht es, ob das schön ist oder nicht, Modulationstechniken wie in der Musik. Die Polarisation soll um 90° gedreht werden. Das geht nicht mit zwei Filtern, mit dreien kommt man aber schon mal deutlich weiter. Darin steckt natürlich das Potential der Verführung, und das will kein Philosoph, der etwas auf sich hält, mißbrauchen, aber eins gilt: “groß Ding will Weile haben”, da hatte Thomas Mann wirklich mal recht.
Juni 14th, 2016 at 15:07
Der obige Post ging an #21, flatter.