
Anlässlich seines Neunzigsten gab es kürzlich die unvermeidlichen Elogen auf Jürgen Habermas, einem treuen Begleiter des deutschen Narrativs, der als Herrprofessor die Instanz war für schlaues Zeugs, das niemandem wehtut. Nun, auf meiner Seite war der Schmerz gelegentlich erheblich, und schlau fand ich das Gequatsche schon gar nicht.
Nach Kant und Nietzsche waren es Denker der Frankfurter Schule, die mich geprägt haben: Adorno, Horkheimer und Marcuse. Eine ähnlich einschlagende Wirkung hatte danach nur noch Foucault. Ich kann von deren Schriften aus dem Stand stundenlang begeistert dozieren, sie zitieren und erklären, was mich daran fasziniert. Aber Habermas?
Er dürfte von denjenigen, die mich nie interessiert haben, derjenige sein, von dem ich am meisten gelesen habe. Seine Leistung: Als Nachfolger Adornos hat er alles kassiert, was die Alten an kritischem Potenzial aufgebracht hatten und durch die matschige Restauration eines Vernunftbegriffs ersetzt, der mit der Demokratisierung der Naziherrschaft nicht in Konflikt geriet.
Scheinriese
Man muss ja nur seinen weitgehend unbekannten Kollegen Wolfgang Fritz Haug lesen, um den Unterschied zu erkennen. Haug hat von Anfang an aufgezeigt, dass es stinkt im Staate; Habermas hat lieber an die von ihm verwaltete Vernunft appelliert. Haug ist Marxist, Habermas Sozialdemokrat, die Karrieren vorprogrammiert – wenn man davon absieht, dass Haug eigentlich aus dem Lehrbetrieb hätte entfernt werden müssen. Ob Haug als ‘Linke’-Mitglied inzwischen auch als Sozialdemokrat gelten muss, mag ich hier nicht bewerten.
Was mir aufstößt, sind zwei Dinge, die mich zu dieser Einlassung bewegen: Inhaltlich kann ich mich an nichts, aber auch gar nichts Substanzielles erinnern, und zwar auch und gerade in Habermas’ Äußerungen zum Tagesgeschehen, für die er so hochgelobt wird. Ich kenne auch niemanden, der das könnte. Ein Ereignis, anlässlich dessen man sich von ihm durchgerüttelt fühlte? Eine scharfe Kritik? Ein relevanter Änderungsvorschlag? Nichts. Dafür ist der Betrieb seinem Star offenbar dankbar.
Damit verbunden ist zweitens das völlige Fehlen eines radikalen Zweifels, wie er noch seine Vorgänger prägte. Kein Zweifel am Denken selbst, am System, an den Grundlagen der Herrschaft oder der Gedanke, dass alles, was als ‘Demokratie’ auftritt, eigentlich etwas anderes meinen könnte. Stattdessen Appelle an eine Vernünftigkeit, die angesichts früherer Theorien und späterer Praxis bestenfalls Rührung hervorrufen. Die Sonne steht tief im Denkerland.
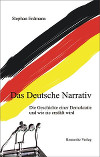


Juni 24th, 2019 at 16:12
Ob Haug als ‘Linke’-Mitglied inzwischen auch als Sozialdemokrat gelten muss, mag ich hier nicht bewerten.
Natürlich nicht, denn die ‘Linke’ will ja schliesslich den Kapitalismus überwinden. Sagt bzw schreibt ein gewisser Riexinger. Doch, doch.
Ansonsten keine Einwände. Man sollte ihn mit allen verfügbaren Preisen und Orden überschütten, meinswegen auch zum zweiten oder dritten Mal. Nur der Kenntlichkeit halber.
Juni 24th, 2019 at 16:27
Ach, und danke für das Bild! :)
Juni 24th, 2019 at 17:42
Btw. hänge ich gerade an einem Vortrag von Haug aus 2012. Die Tonqualität ist mäßig, aber die Sprache deutlich. Kann ich bislang sehr empfehlen. Ich mag es vor allem, wenn einer die richtigen Fragen stellt und deren Abfolge erläutert.
p.s.: Das ist großartig, einschließlich seiner Prognosen.
Juni 24th, 2019 at 19:25
Habermas spricht seit Jahrzehnten in seinen Texten, Schriften und Vorträgen vom Diskurs. Wir sollten mal alle miteinander reden. Das wars im Kern auch schon. Was für eine Erkenntnis! Dafür wird er so hochgelobt. Er eckt nicht an, ist ein Befürworter des Status Quo und damit belanglos.
Empfehlung: Hartmut Rosa.
Juni 24th, 2019 at 20:02
Ich habe nichts gegen Diskurs, aber allein schon anzunehmen, der wäre “herrschaftsfrei”, fällt weit hinter das zurück, was z.B. Foucault darunter versteht. Diskurs ist ein Rahmen, der in einer bestimmten Ordnung gefüllt wird. Wie wir derzeit erleben, führt ein Verlust von Ordnung (etwa durch Propaganda und ‘Fake News’) zu einem Verschwimmen des Diskurses. Man erkennt zunehmend weniger, was sich worauf bezieht, der Diskurs kann keinen Kontext mehr sichern. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass sich eine neue Ordnung bildet, jedenfalls die alte auflöst.
Juni 24th, 2019 at 21:37
Wenn die taz die Grünen angreift und im Cicero zu lesen ist, dass sich unser Wirtschaftssystem im Krieg mit der Natur befinde – könnte was dran sein… ;)
Juni 25th, 2019 at 09:38
Tipp: ROTE RÄTE
Die bayrische Revolution aus der Sicht von Augenzeugen
On Topic: Diese ganze #Habermas-Lobhudelei nervt. Wenn man den frühen Habermas mit dem späteren vergleicht, sieht man sofort, wo das Problem ist. Leute wie Habermas haben die Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule beerdigt & den Soundtrack für die neoliberale Sozialdemokratie geliefert (Raul Zelik)
Juni 25th, 2019 at 11:27
Heißer Scheiß: Rassisten ohne Grenzen (YT, 1:20 min.)
TRRIGGERRWARRNUNNK!!1! Es werden schlimme Wörters für Leute gesagt.
Juni 25th, 2019 at 12:11
OT: Kein Neid, nirgends
Die BMW-Eigentümer*innen Klatten und Quandt erklären in einem Interview ihre Sicht auf Reichtum. Dabei bleiben viele Dinge unausgesprochen.
[..] „Wir wissen, dass Umverteilung noch nie funktioniert hat.“ [..]
Das hätte mal jemand der spd 1959 erklären sollen.
Juni 25th, 2019 at 12:32
Selbst die Besteuerung von Erbschaften ist den beiden ein Greuel: „Ich frage mich immer, warum der Todeszeitpunkt ein Moment sein sollte, in dem der Staat auf bereits versteuertes Einkommen noch einmal zugreift.“
Siehste, entsprechendes frage ich mich jeden Tag an irgendeiner Kasse auch…
Juni 25th, 2019 at 13:17
Manchmal ist Erschießen auch einfach humaner.
Juni 25th, 2019 at 13:44
Jetzt aber festhalten: Schützt das Privateigentum!
Stefan Quandt bei Fatzplus. Man kann nur einen Teil lesen, aber mir reicht das Stückchen bereits.
Lustiges Kerlchen, der Typ. Jetzt verstehe ich, warum diese Leute sehr öffentlichkeitsscheu sind: Sie sind wirklich so, wie man sie sich vorstellt.
Juni 25th, 2019 at 14:07
So ein schönes Grinsegesicht …
Ja hömma, sicher wurde uns das Grundgesetz von Gott gegeben, damit Milliardenerben ungestört weiter den Plebs ausbeuten können. Das wusste schon Karl der August. Wahre Aufklärung beleidigt die Majestät nie.
Juni 25th, 2019 at 15:47
Keine Sorge – man wappnet sich:
Die mehrtägigen Lehrgänge richten sich explizit an Bundestagsabgeordnete und andere Parlamentarier, an “Spitzenkräfte” aus Unternehmen und Gewerkschaften, an hochrangige Beamte, Richter und Staatsanwälte sowie an “ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Bildung, Forschung, Presse und Medien”. [...]
Der Ablauf ist streng formalisiert: Zunächst müssen die Teilnehmer ihre Zivilkleidung gegen eine Kampfuniform der Bundeswehr (“Flecktarn”) tauschen, so dass sie von den regulären Soldaten “nicht mehr … zu unterscheiden” sind, wie die Truppe erklärt. Im Anschluss werden die “zivilen Führungskräfte” für die Dauer des Lehrgangs zu Oberleutnanten “befördert” – Fahneneid inklusive. Integraler Bestandteil des Lehrgangs ist die “Waffenausbildung”: Den deutschen Streitkräften zufolge lernen die Besucher das Gewehr G36, die Pistole P8 und das Maschinengewehr MG4 “unter Anleitung zu laden und damit zu zielen”, um dann selbst den “scharfen Schuss” zu trainieren.
Kann man sich nicht ausdenken, sowas…
Juni 25th, 2019 at 16:21
Allerdings habe ich Naivling bis gestern auch geglaubt, ‘Luftkampfübungen’ fänden keinesfalls über bewohntem Gebiet statt…
Juni 25th, 2019 at 16:42
Na klar, mit Luftpistolen – aufblasbar.
Juni 25th, 2019 at 17:06
OT: “Daten sind das neue Erdöl”: Vorratsdatenspeicherung: Zehn Mobilfunkanbieter gehackt und jahrelang Verbindungsdaten kopiert
*lol*
Juni 25th, 2019 at 17:30
OT.: Nazis in Polizeiuniformen.
»Es gibt in Berlin keinen Polizisten, der nicht AfD gewählt hat«, prahlt im staatlichen Ersten Fernsehen der Oberpfaffe des staatlichen Zweiten, Peter Hahne. Er übertreibt. Nicht alle wählen AfD, manche auch die NPD..
https://konkret-magazin.de/aktuelles/aus-aktuellem-anlass/aus-aktuellem-anlass-beitrag/items/nazis-in-uniform.html
Juni 25th, 2019 at 21:19
“Man verstehe mich nicht falsch. Ich war auch gegen den Krieg. Bin gegen jeglichen Krieg. Finde die USA so miserabel regiert wie Europa, und das gerne. Mag keine Ayatollahs. Aber so doof wie Habermas darf man nicht einmal sein, wenn man das Gute verteidigen will.”
https://konkret-magazin.de/aktuelles/aus-aktuellem-anlass/aus-aktuellem-anlass-beitrag/items/hohler-kern.html
Juni 25th, 2019 at 21:47
Hab mir grad nen kleines Filmchen über Phillip A. angeschaut. Da wo ich Abi gemacht hab hätt der keens machen können,…, Klassenkeile…
Quand, Klatten, Piech,…, wass willst noch dazu sachen, s`gibt eben nich nur den sdddah, s`gibt eben och den sdddkh (…kapitalhalter…). Oder wies flatter schrub…sollnse einkaufen gehn, viel Spass dabei…
Naja, Frau Trulla is wieder die Alte (“ich Nro. uno, wass willst du…”)
Ach Wessis, ihr habt uns jede Menge Kacke seit dem 1. 7. 90 rübergeschickt, hätt gern jetzt nen ordentliches Gewitter, hier im Grossraum Zittau…
Juni 25th, 2019 at 22:53
“Dafür ist der Betrieb seinem Star offenbar dankbar.” Merke: Wer am lautesten nichts sagt wird gehypt, ist der Star! Und dann auch noch Zweifel los; Bundesverdienstkreuz!
Juni 25th, 2019 at 23:00
@Peinhart (10)
Das hab’ ich nie verstanden: Inwiefern hat der Erbe – der dem der Schotter in den Schoß fällt – bereits versteuert? Der iss doch der Steuerpflichtige! Kannze mir das erklären (max. 240 Zeichen plies).
Juni 25th, 2019 at 23:19
@langlode44
Nix, nix! Wer hat denn gebrüllt “Kommt die DeeMark nich zu uns gehn wir zu ihr!” Hä? Wer war das? Unsere Sozialkassen plündern unn dann auch noch frech wärn! ;-)
Gruß nach Zitau, und an Frau Trulla.
Juni 26th, 2019 at 13:18
@Vogel(22): Ist doch ganz einfach; wenn ich im Laden meine Gehaltsabrechnung zeige, ziehen die ja auch sofort 19% ab, weil mein Geld ja versteuert ist.
Das Milliardärsarschloch meint, wenn sein Vater die Kohle schon erfolgreich mit allen Tricks in Höhe von 1% versteuert hat, ist das für alle Ewigkeit Familieneigentum. Alles andere ist brutale Enteignung. Er ist schließlich kein Prolet, dem von dem bisschen, was er hat, alles Mögliche abgezogen wird. Dafür beantragt er auch kein ALG II, ist doch nur fair.
Juni 26th, 2019 at 13:20
Aus dem dritten Bogen über die Grünen von Michael Jäger:
Die [innergrünen] Linken blieben auch nach dem Massaker in der UN-Schutzzone Srebreniza im Juli 1995 bedingungslose Pazifisten, während Fischer diese Position aufzugeben begann. Er nahm damals an einem Salon teil, den Jürgen Habermas unterhielt. Habermas vertrat die Ansicht, dass die Universalität der Menschenrechte den militärischen Eingriff in souveräne Staaten rechtfertige.
Eine solche Position kann man ja vielleicht noch vertreten – man sollte sich aber überlegen, innerhalb welcher Strukturen man das macht und ob es dafür überhaupt geeignete Institutionen gibt. Wenn ‘Moral’ erkennbar nicht mehr der Begrenzung und Vermittlung sondern vielmehr der Entgrenzung und Betonung von Interessen dient – wie es sich in einer entfesselten Konkurrenzgesellschaft ziemt – dann kann man eine solche Position konkret eben nicht vertreten. Dann müsste eben erstmal diese Konkurrenzgesellschaft selbst zum Thema werden.
Juni 26th, 2019 at 13:39
Was ist das dannn? Moralischer Utilitarismus? Welch eine Pfeife!
Juni 26th, 2019 at 13:55
flatter, iss doch klar dass Mwst. gezahlt wird, unten relativ viel, oben fast nix, gelle! Der Rest iss auch klar: Papa scheffelt Bimbes – weil die Voraussetzungen da sind oder geschaffen sind – und zahlt einen Steuerobulus für seine Einnahmen … und dann der Erbe auch, mit seiner Einnahme (= Erbe); da iss nix mit 2x Steuer zahlen, jeder einmal!
Juni 26th, 2019 at 14:06
Erklärst du das jetzt mir? Ich bin keine Dynastie, für mich gelten Regeln. Also die für den Plebs jetzt.
Juni 26th, 2019 at 14:53
OT: Schöner Kommentar: Warum Heiko Maas’ Aufruf eine Zumutung ist
Ein Minister ruft die Bevölkerung zum Protestieren auf, um die Regierung, der er angehört, zum Handeln zu bewegen. Geht’s noch?
Juni 26th, 2019 at 23:09
Du gehst einkaufen (= Lohnabrechnung vorzeigen) – Dynastie geht einkaufen = 19 % Mwst. (oder welche Steuer meinst Du sonst??)
Du hast Einkommen und zahlst brav Deine Steuern – Erbe hat Einkommen … und soll gefälligst davon Steuern zahlen. Nix anners steht da, oder?
Juni 26th, 2019 at 23:26
Vielleicht brauchen wir ein Ironieschild?
sleep well
Juni 27th, 2019 at 10:26
OT: Da denkt mal jemand laut nach: Plattform-Sozialismus
Juni 27th, 2019 at 11:09
Der Charme dieses Ansatzes liegt vor allem darin, dass es den Gegensatz von Markt und Planung dadurch aufhebt, dass es die Planung sozusagen in jeden einzelnen Haushalt verlegt. Das hat insofern ‘Marktcharakter’, als jeder jederzeit – bzw mit nur ein wenig Vorlauf – seine ‘individuellen Präferenzen’ artikulieren könnte, es aber andererseits dafür keine chaotische Produktion ‘auf Verdacht’ mehr geben bräuchte.